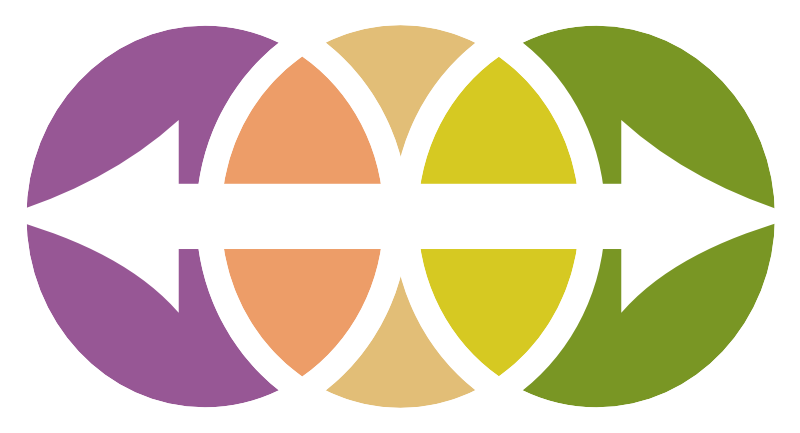Konstruktivistische Werkstattarbeit – Permanente Zukunftswerkstatt
„Politische Bildung und Demokratie ganz nah“ – das Konzept des lernenden Stadtteils.
Politische Bildung ermöglicht Lernprozesse, die Selbstwirksamkeit als das Einmischen mit seinen Interessen und Ideen als sinnstiftend erleben lässst. Dies gilt für die Bürger*innen, Verwaltung, Politik und die anderen Partner*innen, die an der Gestaltung des Stadtteils beteiligt sind.
Die Prozesse, die durch politische Bildung begleitet werden, stehen auf der Grundlage der Demokratie und der Menschenrechte. Politische Bildung ist der Demokratisierung der Strukturen, den Lernprozessen bei allen Beteiligten, Lernprozessen im Stadtteil, die es mit den Menschen auf demokratische Weise zu gestalten gilt, verpflichtet. Dabei spielen Dialog, die Streitkultur und die gemeinsame Zukunftsgestaltung in demokratisch-solidarischer Verständigung zentrale Rollen, die es zu fördern gilt. Damit steht politische Bildung nicht auf irgendeiner Seite der Beteiligten, sondern befördet.
Demokratie auf allen Ebenen. Sie kann mit den entsprechenden Partner*innen und entsprechender Offenheit, Dialog und Perspektiven entwickeln helfen.
Politische Bildung kann gesellschaftliche Fragestellungen und Problemlagen vor Ort in den Stadtteilen in individuelle und kollektive Lernanlässe übersetzen helfen, um selbstwirksame Prozesse unter Inklusion (Willkommenskulturen) und Partizipation (Beteiligungskulturen) zu initiieren und zu begleiten. Dabei spielen demokratische Grundprinzipien auf allen Ebenen zentrale Rollen. Das bedeutet, dass sowohl der Einzelne sich als Akteur*in seiner Selbst und seines Umfeldes begreift und ermutigt wird, seine Ideen und Vorstellungen einzubringen und aber auch der Stadtteil selbst geeignete Formate bietet, um selbstbestimmtes Handeln und Erfolgserlebnisse für den Einzelnen aber auch Initiativen schafft. Dabei sind die Strukturen vor Ort selbst im besten Fall getragen vom bürgerlichen Engagement für den Stadtteil und das Gemeinwesen. Zur Demokratie gehört auch die Austragung und der Interessensausgleich. Politische Bildung hilft, diese Orte der Auseinandersetzung gemeinsam zu erarbeiten und zu meistern, um vor Ort für das Gemeinwesen streiten zu können. Dabei kann politische Bildung auf vielfältige Beteiligungsformate und jahrzehntelange Erfahrung zurückgreifen und sie vor Ort individuell einsetzbar machen: Zukunftswerkstatt, Dialog, Community Organizing, Extremismusprävention, ANTI- BIAS, Betzavta und Dialogforen, dialogische Stadtspaziergänge, Verbindungen zu vielfältiger institutioneller politischer Bildungsarbeit (Gedenkstätten, Erinnerungskultur), Prozessbegleitungskonzepte inklusiver Stadtteilentwicklung, Konzepte von informeller bis hin zu formaler Beteiligung bis in die Kommunalstrukturen hinein, lassen Demokratie für den Einzelnen erlebbar werden. Dabei sind die informellen Beteiligungsstrukturen eines lernenden Stadtteils nicht als Konkurrenz zu bestehenden formalen Beteiligungen zu sehen, sondern eher als ergänzendes Instrument niedrigschwelliger Beteiligung. Diese Strukturen orientieren sich an den Prinzipien von lernenden Organisationen, bei denen gezielt Funktionen und Kompetenzen innerhalb eines Stadtteiles entwickelt werden, um nachhaltiges eigenständiges Lernen im Sinne des Gemeinwohls zu etablieren. Dabei hilft politische Bildung, unterschiedlichste Zielgruppen den Zugang zu Beteiligung zu ermöglichen. Dabei sind die eingesetzten Methoden Sprachrohr von Interessen, die im Stadtteil von den Beteiligungsstrukturen gehört und in Handeln geleitet werden. Koordinierende und strukturierte Aufgaben liegen in den Händen der Bürger im Viertelsrat bzw. in Steuergruppen, die großen Themen werden aufgenommen im Rahmen von Viertelsratschlägen/Bürgerforen unter breiter Beteiligung, Aktive tauschen sich aus und planen und unterstützen sich gegenseitig in Projektstammtischen. Überprüfende und evaluierende Aufgaben werden durch übergreifende Gremien geleistet und rückgekoppelt. Politische Bildung hat dabei Schulen, Bürgerinitiativen, einzelne Akteure im Stadtteil, oder breiter Bündnisse im Blick, um sie an die selbstorganisierte Teilhabestruktur anknüpfen zu lassen.
Politische Bildung selbst ist dabei aber auch nur Partner der zivilgesellschaftlichen und kommunalen Strukturen. Die Strukturen vor Ort können nur mit Hilfe von z. B. der Montag Stiftung mit der UNS in Krefeld, Kommunen und der Gemeinwesenarbeit (Quartiersentwicklung) entwickelt werden, um genau die zu erreichende Selbstwirksamkeit zu schaffen. Dabei bietet politische Bildung die Chance, auf informelle und formale Beteiligungsformate mit weitgehender Selbstbestimmung (aufgrund des Selbstverständnisses politischer Bildung) zurückzugreifen, die für alle Beteiligte einen Mehrwert bieten, da sie im Prinzip inklusiv ausgelegt sind und Vielfalt als willkommen betrachtet. Dabei können WerkstattTage als demokratische inklusive Plattformen mit visionärer Zukunftsausrichtung den konstruktiven Dialog unterstützen und bereichern.Diese Prinzipien, Grundsätze und Prozesse sind beschrieben in „Zukunft gestalten in demokratisch-solidarischer Verständigung – Praxisleitfaden für eine nachhaltige Demokratisierung und eine inklusive-partizipative Prozesskompetenz in der Bildungsarbeit ( https://kups.ub.uni-koeln.de/9476/ ). Dabei werden demokratische Strukturen auf der Basis des „viable system models“ und seinen Verantwortungs- Kompetenz- und Funktionsrastern entwickelt, mit den Beteiligten und nicht für. Dies spiegelt sich auch wieder in: der Qualifizierung zur (Inklusions-)prozessbegleitung – dem Fortbildungskonzept vom DIE.WERKSTATT/Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft auf Basis der Konstruktivistischen Werkstattarbeit.
Eine wie in diesem Beispiel ausgerichtete „Aufsuchende Politische Bildung“ lässt sich theoretisch und praktisch auf vielfältige „demokratische Räume“ übertragen. Dabei sind jegliche Organisationen und Strukturen in den Blick zu nehmen und unter dieser Perspektive zu entwicklen. (vgl hierzu auch www.aufsuchende-politische-bildung.de Fachgruppe NRW)
„Democracy as a lived experience“ (Dewey)